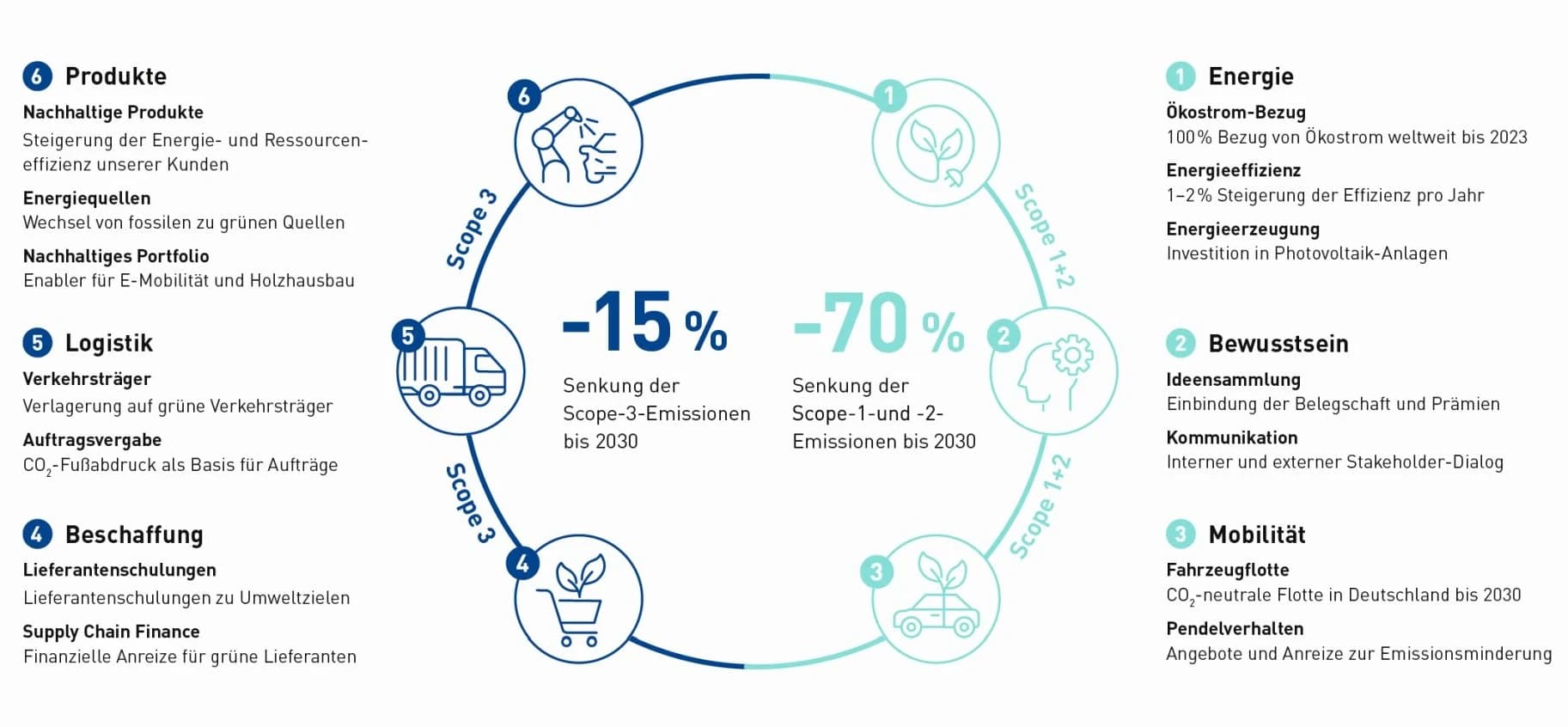Zukunft in den schönsten Farben
Lange war sie eine Vision - jetzt wird sie Wirklichkeit: Die Lackieranlage der Zukunft leitet eine neue Ära der Automobilproduktion ein. Starre Systeme weichen Modulen, die flexibel angefahren werden können und dadurch noch effizienter werden. Dazu gehören kompakte Lackierboxen, sparsame Trockner, sekundenschnelle Farbwechsel sowie die Nutzung überschüssiger Wärme. Wie auf einer Perlenkette reiht sich in den Automobillackieranlagen der Welt eine Arbeitsstation an die nächste. Nach einem strengen Takt sprühen die Roboter Lack auf Karosserien, der dann in Trocknern aushärtet. Diese starre Logik des Fließbands hat sich über Jahrzehnte bewährt. Sie passt aber nicht mehr in eine Zeit, in der immer mehr Modellvarianten in bestehenden Anlagen gefertigt werden sollen. Zudem drängen neue Wettbewerber auf den Markt und Umweltvorschriften werden strenger. Dürr arbeitet deshalb seit Langem an einem Konzept, das diesem Wandel Rechnung trägt. Die Lackieranlage der Zukunft begann vor vielen Jahren als Skizze, die Entwickler auf eine Serviette kritzelten, als sie während einer Dienstreise in einem japanischen Café eine Pause machten. Heute wird sie in der Realität gebaut. Ihre hervorstechende Eigenschaft ist Flexibilität. „Sie besteht aus unterschiedlichen Lösungen, die unsere Kunden immer neu auf ihre Bedürfnisse zuschneiden können“, sagt Produktmanagerin Corinna Maier. Die Lackieranlage kann sich ohne Produktionsstopp wechselnden Stückzahlen oder veränderten Modellen anpassen. Der Einsatz effizienter Produkte, innovativer Energieverbundsysteme und intelligenter Software schont außerdem Ressourcen. Eine Auswahl der Komponenten: Lackierbox erschließt neue Wege Die Lackieranlage der Zukunft ist ganz anders aufgebaut, als es bisher der Fall war. Statt langen linearen Lackierstraßen enthält sie Lackierboxen, die nebeneinander stehen. Dieses Boxenkonzept spart Platz und macht das Lackieren flexibler. Die Lackierboxen der aktuellen Generation tragen den Namen EcoProBooth. Sie sind kompakt und mit vier Lackierrobotern ausgestattet, die Außen- und Innenseite der Karosserie in einem Arbeitsgang lackieren können. Bislang waren hierfür drei Lackiertakte nötig. Zentrale Merkmale der Lackieranlage der Zukunft sind Flexibilität und Modularität. Die traditionelle Lackierstraße ist pausenlos in Betrieb. Mit dem bausteinartigen Boxenkonzept lassen sich einzelne Kabinen vorübergehend stilllegen, wenn weniger Autos bestellt werden. Das senkt die Betriebskosten. Steigt die Nachfrage, kann der Hersteller die Produktion zügig wieder hochfahren. Und wächst die Nachfrage weiter, funktioniert das Szenario auch: „Weitere Lackierboxen können im Handumdrehen aufgestellt werden“, sagt Frank Herre, Leiter der Applikationsentwicklung. Wochenlange Produktionsstopps während eines Umbaus, wie sie in starren Lackierstraßen nötig waren, gibt es nicht mehr. Die EcoProBooth hat einen weiteren Vorteil: Autohersteller fertigen unterschiedliche Modelle auf derselben Linie. Dabei bestimmen die großen Fahrzeuge, wie lang ein Arbeitsschritt dauert, auch wenn sie nur einen Teil der Produktion ausmachen. Kleine Karosserien lassen sich zwar schneller lackieren, doch sie müssen den Takt der großen mitmachen. Das kostet Zeit. Das neuartige Boxenkonzept erlaubt unterschiedlich lange Takte, da die Karosserie in nur einer Station lackiert und direkt ausgefördert wird. Das nächste Modell kann ohne Verzug nachrücken. Das spart Zeit und erhöht das Produktionsvolumen. Ein anderes wichtiges Element sind kleine Wartungsfenster in der Lackierkabine. Durch sie lassen sich die Lackzerstäuber der Roboter einfach reinigen oder reparieren, ohne dass die ganze Linie angehalten wird. Nur der verschmutzte Roboter unterbricht die Arbeit und hält seinen Kopf ins Wartungsfenster. Von einer gut belüfteten Zelle aus lasse sich der Zerstäuber reinigen, sagt Produktmanager Daniel Ackermann. „Bislang musste ein Mensch mit Atemschutz die Kabine betreten und brachte womöglich Schmutz mit hinein, der dann auf den frischen Lack gelangte und aufwendig repariert oder herauspoliert werden musste.“ Allein für ihre Reinigung steht eine herkömmliche Lackierkabine durchschnittlich anderthalb bis zwei Stunden pro Tag still. Mit den Wartungsfenstern dauert die tägliche Produktionsunterbrechung keine fünf Minuten. Der Alleskönner Damit die Karosserien in derselben Box von innen und außen lackiert werden können, brauchen die Roboter einen besonders variablen Hochleistungszerstäuber. Er muss seinen Sprühstrahl so lenken und dosieren, dass er jede Stelle möglichst schnell und gründlich trifft – aber ohne dass Farbe verschwendet wird. Diese Fähigkeit bringt die neue Zerstäubergeneration EcoBell4 mit. Sie ist so etwas wie die Königsklasse unter den 120 Dürr-Zerstäubern und kann alle bekannten Automobillacke auftragen. Bei der Entwicklung haben die Fachleute eine Technologie erarbeitet, die sie zum Patent angemeldet haben: „Die Farbe ist in nur vier Sekunden gewechselt“, sagt Entwickler Thomas Buck. Ältere Systeme benötigen für diesen Vorgang zwischen 15 und 25 Sekunden. Bei einer Fabrik, die 60 Fahrzeuge pro Stunde fertigt, ist die Zeitersparnis enorm. Der Farbwechsel gehört zu den Arbeitsschritten, die besonders schnell gehen müssen. Blitzschnell schießt Spülmittel durch die Düsen des Zerstäubers, bevor die Farbreste mit Druckluft entfernt werden. Dann strömt der neue Lack durch einen eigenen Farbkanal ein. Neu ist auch die digitale Dokumentation des Lebenszyklus der Zerstäuber über RFID-Technologie. Sie erfasst die Daten der Bauteile, etwa wie lange sie im Einsatz waren, und zeigt die verbliebene Restlebensdauer an. Komponenten lassen sich so rechtzeitig austauschen, was ungeplante Fertigungsunterbrechungen vermeidet. Querfahrt durch den Trockner Ist der Lack aufgetragen, muss die Karosserie trocknen. Das geschieht in bis zu 190 Grad heißen Trocknern. Im Vergleich mit konventionellen Lacktrocknern kann der elektrisch betriebene EcoInCure bis zu 70 Prozent Energie einsparen. Nicht nur die Betriebskosten werden damit enorm reduziert. Mit dem Einsatz des EcoInCure lässt sich bei Verwendung von Ökostrom der CO2-Ausstoß der gesamten Lackieranlage um bis zu 40 Prozent senken. Starke Düsen lenken den Heißluftstrom im Trockner so in und auf die Karosserie, dass sie sich schneller erwärmt. Das spart Zeit, aber auch Platz, weil die Anlage mit der halben Länge und der halben Höhe eines herkömmlichen Trockners auskommt. Anders als bisher bewegen sich die Karosserien quer durch den Trocknertunnel. „Dadurch kann heiße Luft durch die Öffnung für die Windschutzscheibe einströmen und erreicht schwer zugängliche Teile im Innern der Karosserie. Darunter fallen massive Gussteile, sogenannte Gigacastings, oder auch die Tunnelverstärkung“, sagt Produktmanager Heiko Dieter. Das ist besonders bei Elektroautos von Vorteil. „Wegen ihrer schweren Batterien sind E-Autos unterhalb des Türeinstiegs verstärkt“, erläutert Dieter. Diese sogenannten Schweller sind für herkömmliche Trockner schwer erreichbar. Die intelligent gerichtete Wärmeströmung im EcoInCure erreicht die Klebestellen des Schwellers und härtet diese aus. Das ist wichtig für die Crashsicherheit. EcoInCure behandelt mit nahezu unveränderter Trockenleistung verschiedenste Karosserien: vom flachen Sportwagen bis hin zum SUV. Lebensadern der Lackieranlage Da das Lackieren viel Energie verbraucht, arbeitet Dürr laufend an sparsameren Anlagen. Zu den Innovationen gehört das Energieverbundsystem EcoQPower. Es richtet den Blick auf die gesamten Energieströme der Lackieranlage. Mithilfe einer eigens entwickelten Software analysieren Spezialisten den Kälte- und Wärmebedarf der einzelnen Module und vernetzen sie intelligent, sodass nur wenig Energie ungenutzt bleibt. Was theoretisch klingt, macht das Beispiel der kathodischen Tauchlackierung (KTL) deutlich. In den Tauchbecken wird Lack mithilfe von elektrischem Strom aufgetragen, denn das schützt die Karosserien besonders gut gegen Korrosion. Dabei entsteht Wärme – die bislang mit der Abluft nach draußen ging. EcoQPower macht diese Energie nutzbar: Wärmepumpen entnehmen dem Becken die Wärme und führen sie anderen Prozessschritten zu. In ähnlicher Weise arbeitet das System an weiteren Stellen. Das intelligente Wärme-Kälte-Verbundsystem ist seit Kurzem erstmalig bei einem Hersteller in Europa in Betrieb. Tests haben ergeben, dass die Fabrik mit EcoQPower über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg knapp ein Fünftel der CO2-Emissionen einsparen wird. Die neue Lackieranlage ist damit die erste, die konform mit den Anforderungen der EU-Taxonomie ist, dem Klassifizierungssystem für nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Natürlich senkt EcoQPower nicht nur die Emissionen, sondern auch die Kosten. Das ist insbesondere beim Umstieg von Gas auf Grünstrom wichtig. Da Gas in der Regel günstiger ist als Strom, würden durch die Umstellung höhere Betriebskosten anfallen. „Der Anstieg der laufenden Betriebskosten lässt sich durch die Energieeinsparungen von EcoQPower teilweise oder sogar ganz kompensieren“, sagt Produktmanagerin Corinna Maier. Fachleute von Dürr tüfteln auch an anderen Innovationen, die das System erweitern. Zum Beispiel werden Wärme- und Kältespeicher ergänzt, um Energie zu speichern, wenn Elektrizität günstig bezogen werden kann. Das würde zu noch mehr Flexibilität führen. Und das ist schließlich das wichtigste Ziel für die Lackieranlage der Zukunft.